Die Betäubung der Einsamkeit
Gerade stand ich mit meinem etwas teuren, aber vorzüglichen Kaffee an der Kasse des etwas teuren, aber fußläufigen Supermarkts. Vor und hinter mir hatten sich zwei ältere Personen eingereiht. Hinter mir eine Dame undefinierbaren Rentenalters, sofern nicht tragische Umstände und ein übermäßiger Konsum diverser Stoffe für eine vorzeitige Alterung gesorgt hatten. Sie trug eine grüne Sportjacke zur rosafarbenen Mütze und machte sonst den Eindruck einer rüstigen Mallorcarentnerin. Ihre stark zitternden Hände legten vier Päckchen jener schmalen, dekorativen Zigaretten auf das Band, die gemeinhin Nuttenstängel genannt werden. Und eine Flasche Eierlikör.
Doch eigentlich geht es um den Herrn vor mir. Die Dame scheint mir die passende Fußnote zu sein – oder: die spiegelnde Ergänzung. Der Herr fiel mir zuerst über das Sortiment seiner Waren auf, sonst zeichnete ihn nichts aus, was nach einem flüchtigen Blick dazu geführt hätte, dass ich mich länger mit ihm beschäftige. Sein Einkauf bestand aus acht Bananen, einer großen Flasche Wein, zwei kleinen Flaschen Wein und einer Packung Mon Chérie. Etwas aus dem Keller meiner Erinnerungen kam bei diesem Anblick nach oben gestampft, klopfte hartnäckig an der Tür zu meinem Bewusstsein und zwang dieses, sich den Herrn näher zu besehen.
Mein Onkel, dachte ich.
Da mein Onkel bereits seit einigen Jahren tot ist, wird dies keine Erzählung eines unerhofften Wiedersehens. Wäre er es gewesen, wäre es ein unheimliches Wiedersehen geworden. Der Fremde sah meinem Onkel nicht einmal ähnlich, doch er gehörte zur selben Gattung: diesen einsamen Geistern, die wir am Rande unseres Lebens und Treibens wahrnehmen. Meistens sind es Männer, graue Herren, die viel ihrer Zeit verloren haben und sich in dem verbliebenen Rest verlaufen. Trotz ihrer meist sehr akuraten Erscheinung haftet ihnen ein trauriger Film an, so als hätte jemand über sie einen gräulichen Filter gelegt. Sie sind wie ein leeres Haus, dessen Fassade gepflegt wird und dem man dennoch ansieht, dass es seit Jahren niemand mehr bewohnt.
Schon vor dem Tod meiner Tante muss mein Onkel an einer Einsamkeit gelitten haben, die er nur zu betäuben wusste. Wir haben es erst sehr viel später erfahren und noch später begriffen, eigentlich erst in der Zeit vor seinem stillen Heiligabendabgang. Das heimliche, das selbstverständliche Trinken, das behagliche Einrichten in einer gefährlichen wie mit peinlicher Berührtheit akzeptierten Sucht, die ihn immer mehr ausgehöhlt hatte, aber zumindest vorübergehend half, die innere Leere zu vergessen.
Das Ringen um die Fassade, das Wahren des Selbstbildes, das einen irgendwie noch zusammenhält. Mon Chérie hat mein Onkel ebenfalls gegessen. Die Schokolade war der Mantel des Naschens, der das Drängen nach der Betäubung auch vor ihm selbst verhehlte. Wie der Mann an der Kasse, der der Kassierin wortlos einen großen Schein gab, hat auch mein Onkel ausschließlich mit Fünfzigern bezahlt – egal, um welchen Betrag es ging. Die bescheidene Ernährung umfasste immer Bananen und Kiwis in rauen Mengen, der Vitamine wegen.
Wir haben uns damals gefragt, ob wir mehr hätten unternehmen können, aber wir lebten in verschiedenen Städten – und dennoch war es nicht wenig, was wir getan hatten. Mein Onkel wollte es nicht. Jeglichen Versuchen, seinem Dasein einen neuen Impuls zu geben, verweigerte er sich. Er hatte sich in seiner Einsamkeit eingerichtet, auch in seinem Leiden daran, und auf eine seltsame Weise gab ihm dies eine rituelle Beständigkeit, die das ersetzte, was ihm fehlte.
Das Leiden kenne ich, sagte mir einmal ein Freund, der früh zum Alkoholiker wurde. Das andere macht mir Angst.
Was machen wir mit unserer Einsamkeit?
Der graue Geist vor mir an der Kasse, der den sorgsam gefalteten Fünfzig-Euro-Schein aus dem Portemonnaie geholt hatte, ließ das Wechselgeld achtlos in seine Hosentasche gleiten. Er verpackte die drei Flaschen Wein und die Mon Chérie in eine blickdichte Plastiktüte, die Bananen nahm er in die Hand, und so verließ er auffällig genauen Schrittes den Supermarkt, während die alt-hippe Dame mir ihre Lunge in den Nacken hustete.





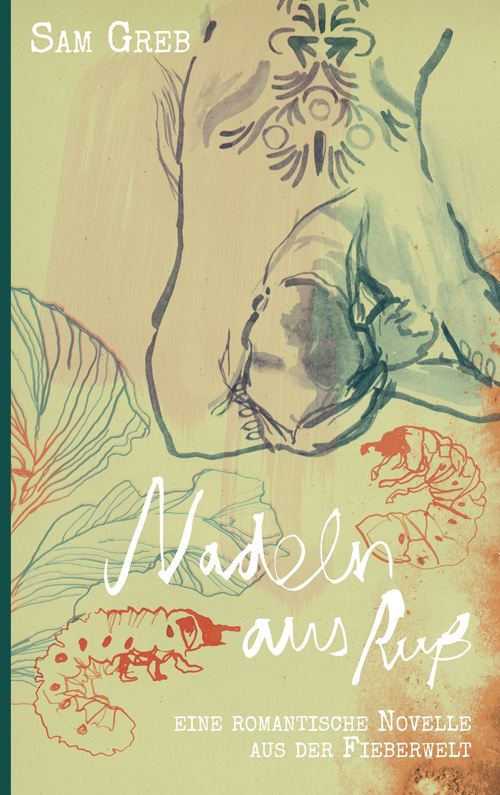
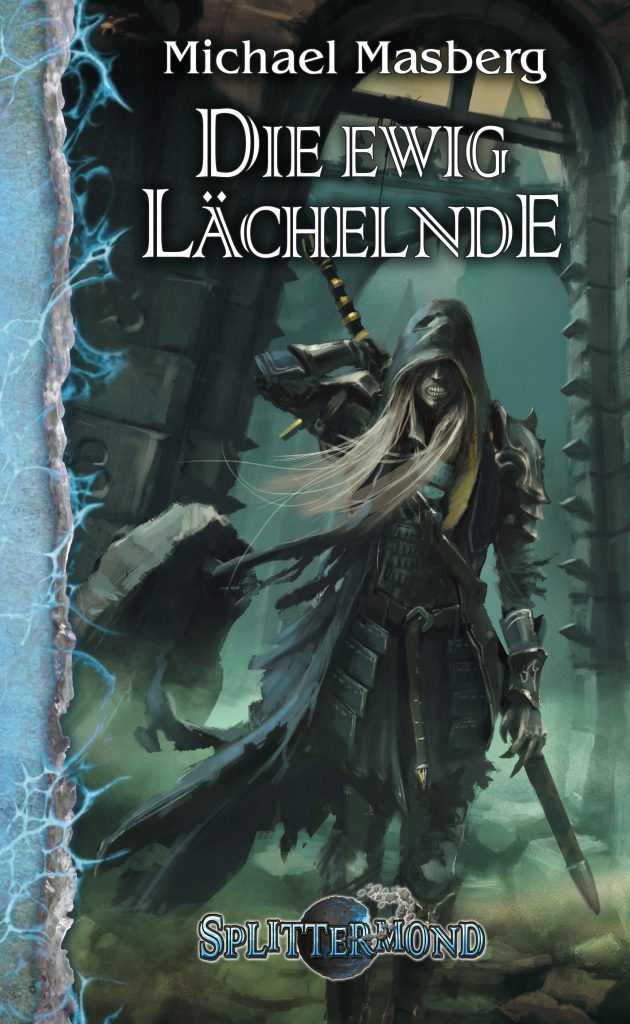

Gratulation, du hast das Leben deines Onkels perfekt beschrieben.
Ich habe mich auch oft gefragt, ob ich hätte mehr tun können. Aber
ich glaube, es war schon gut so.
Mutter