Mindestlohn am Theater?
In der Friseurbranche haben sich die Tarifpartner auf einen Mindestlohn von 8,50 € geeinigt. Das ist toll! Doch was ist mit dem Theater, diesem leuchtenden Ideal kapitalistischer Selbstausbeutung? Nicht erst seit jüngstem sind die Arbeitswidrigkeiten und Gagenmissstände bei institutionellen wie freien Theaterproduktionen ein Thema. Ich war nun neugierig und habe mich hingesetzt, um zu schauen, was ein Mindestlohn für Theater bedeuten würde. Als Rechenbeispiel nehme ich den härtesten Job am Theater: den Regieassistenten.
Die monatliche Mindestgage am Theater beträgt 1.600 €. Dies ist das Einstiegsgehalt sowohl für Schauspieler als auch für Regie-, Ausstattungs- oder Dramaturgieassistenten, in der Regel also Menschen, die ein abgeschlossenes Studium in der Tasche haben. (Mich selbst sehe ich da als Ausnahme.) Facharbeiter verdienen mehr, aber das wissen wir schließlich.
Das Nervenzentrum der Produktion
Der Regieassistent ist in der Regel der am meisten beschäftigte und am schlechtesten bezahlte Beruf am Theater. (Nur unterboten vom Regiehospitanten, der selten mehr als ein Dankeschön bekommt.) Als Regieassistent ist man das Nervenzentrum einer Produktion. Man ist der Verbündete des Regisseurs, das unermüdliche Helferlein der Schauspieler, Ansprechpartner für wirklich alle Abteilungen. Die Jobbeschreibung lässt sich mit drei Sätzen zusammenfassen: “Ich kümmere mich darum. Ich weiß es. Ich bin schuld.” Neben Organisationstalent sind künstlerisches Gespür, Kreativität und Seelsorge gefragt. Von dem Druck, der auf einem lastet, mal ganz zu schweigen.
Die monatlichen Arbeitsstunden sind schwer einheitlich zu erfassen. Von Montag bis Freitag erwarten den Regieassistenten in der Regel täglich zwei Probeneinheiten á vier Stunden. Dazu kommen die ganzen Vorbereitungen, Telefonate und Sitzungen außerhalb der Probenzeit, so dass ein Arbeitstag locker zehn Stunden beträgt, in der Regel mehr. Den Extremfall der Endproben, bei denen zwischen der Vormittags- und Abendprobe noch die Beleuchtungsproben liegen, man also zwischen 8.30 und 9.00 Uhr das Theater betritt und es häufig ohne Pause gegen 23.00 Uhr wieder verlässt, lasse ich für diese Betrachtung außer acht. Nehmen wir also ein durchschnittliches Minimum von 10 Arbeitsstunden wochentags an, sind wir schon bei 50 Arbeitsstunden.
Mit wochentags ist es aber noch nicht getan. Es gibt noch die Probe am Samstagvormittag, mit Vor- und Nachbereitung nochmals 5 Stunden. Zur Aufgabe des Regieassistenten gehört zudem die Abendspielleitung der Stücke, die er betreut. Und Vorstellungen gibt es natürlich auch am Wochenende. Zu der reinen Spielzeit des Stückes – von 45 Minuten bis mehrere Stunden ein breites Spektrum – gesellt sich die Vorbereitung: Kontrolle der Grundeinrichtung, Anwesenheitscheck der Schauspieler, Einweisung der Statisten, das Lösen unerwarteter Probleme … Eine bis eher zwei Stunden vor Stückbeginn sollte man schon an der Bühne sein. Nehmen wir an, dass ein durchschnittliches Stück mit Pause zweieinhalb Stunden dauert und der routinierte Assistent anderthalb Stunden vorher im Haus ist – kritische Zwischenfälle sind also ausgeblieben –, sind dies 4 Stunden Arbeit pro Vorstellung.
Nota bene: Ja, es gibt Ruhezeiten. Aber Hand aufs Herz: Wann lassen sich diese als Regieassistent wirklich einhalten?
Rechnungen, die man nicht machen sollte
Ein durchschnittlicher Monat hat 30 Tage, von denen per se erst einmal keine frei sind. Gehen wir von vier Wochenenden aus, bleiben 22 Tage á 10 Arbeitsstunden. Dazu gesellen sich 4 Samstage á 5 Arbeitsstunden. Jetzt ist das Repertoire breit aufgestellt, es gibt mehrere Regieassistenten am Haus, man muss also nicht jeden Wochenendtag ran an die Abendspielleitung – aus eigener Erfahrung weiß ich aber, dass mit mindestens vier Vorstellungen an einem Samstag oder Sonntag im Monat zu rechnen ist. Macht zusätzlich viermal 4 Arbeitsstunden. Das sind 256 Arbeitsstunden im Monat. Übernahmen für einen kranken Kollegen und Endproben nicht miteinbezogen.
Eine 64-Stundenwoche. Die Realität überschreitet aber schnell die 70-Stundenwoche oder durchschlägt die 80-Stundengrenze. Aber bleiben wir bei den 64 Stunden, also einem recht normalen, geradezu entspannten Arbeitsmonat. Bei einem Einstiegsgehalt von 1.600 € ergibt dies einen Stundenlohn von 6,25 €. Brutto. Mit dem in der Regel höheren Arbeitsaufwand, sinkt der Stundenlohn schnell unter 5 €. Als ich mir vor einigen Jahren mal den Spaß gemacht habe und in einem wirklich harten Monat meinen Stundenlohn ausrechnete, kam ich auf etwa 2,50 €.
Für einen Beruf, der als Nervenzentrum eine Produktion am Leben hält, ohne den ein reibungsloser Ablauf gar nicht denkbar wäre, der häufig von studierten Menschen ausgeübt wird, ist dies ziemlich ernüchternd. Ein Beruf zudem, bei dem Karrieresprünge eher selten sind und angesichts der bedrohlichen Situation kultureller Einrichtungen immer seltener werden. Trotzdem gibt man sich der Ausbeutung hin, beutet sich mit Freuden selbst aus, denn es ist ein toller Beruf und schließlich erhofft man sich Chancen, das Anhängsel “Assistent” eines Tages abstreifen zu können.
Und nun der Mindestlohn
Mit einem Mindestlohn von 8,50 € – was schließlich auch nur eine Untergrenze darstellt und noch immer zum Verzicht auf viele lebenswerte Dinge zwingt – würde das Assistentengehalt in meinem Rechenbeispiel immerhin schon bei 2.176 € Brutto liegen. Realistischer sind 300 Arbeitsstunden im Monat, damit wären wir bei 2.550 € Brutto. Damit macht man immer noch keine Luftsprünge, aber die Zahlen wirken auf mich schon einmal freundlicher.
Dies sollte natürlich nicht nur für Regieassistenten gelten, sondern für alle Berufe am Theater, die diese wunderbare Kunst am Leben halten und mit Leben füllen. Es ist bitter, dass es eigentlich überflüssig ist, zu erwähnen, das dies nicht eintreten wird. Die Theater könnten es sich schlichtweg nicht leisten. Ohnehin sind in den letzten zehn Jahre schätzungsweise 6.000 Stellen im künstlerischen und nicht-künstlerischen Bereich abgebaut worden. Bei Gehaltsverhandlungen verweist man auf die leeren Kassen: Man würde gerne, wenn man könnte.
Die Verantwortung liegt hier wieder einmal bei der Politik, die sich gerne mit gutlaufenden Häusern von weitläufigem Ruf schmückt, gleichzeitig aber finanzielle Beschränkungen diktiert und wortlos die Ausbeutung von Menschen fordert, die im Falle eines Stadttheaters direkt oder indirekt Angestellte sind. Munter wird der Kulturetat – der nicht nur Institutionen wie Stadttheater betrifft, sondern auch freie Projekte – weiter gestrichen, da man keine einflussreiche Lobby fürchten muss. Dabei liegt er meist ohnehin schon unter 1% des Jahreshaushaltes, im Falle des Landes NRW gar bei 0,33%. Kürzungen sind hier also Makulatur, täuschen aber politisches Handeln angesichts leerer Kassen vor. Die Folgen sind fatal, wird letztlich doch die Kultur mit allen Multiplikatoren beschädigt.
Sieht man das Theater auch als Spiegel der Gesellschaft, sollte man darüber nachdenken. Und nicht dazu schweigen.





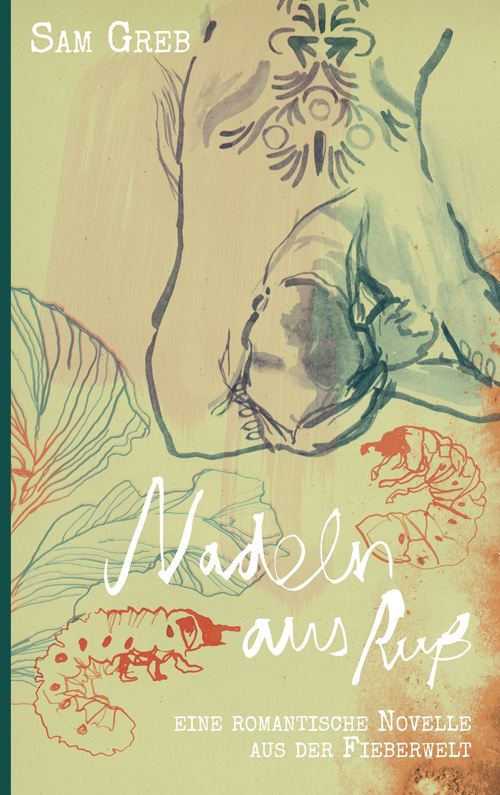
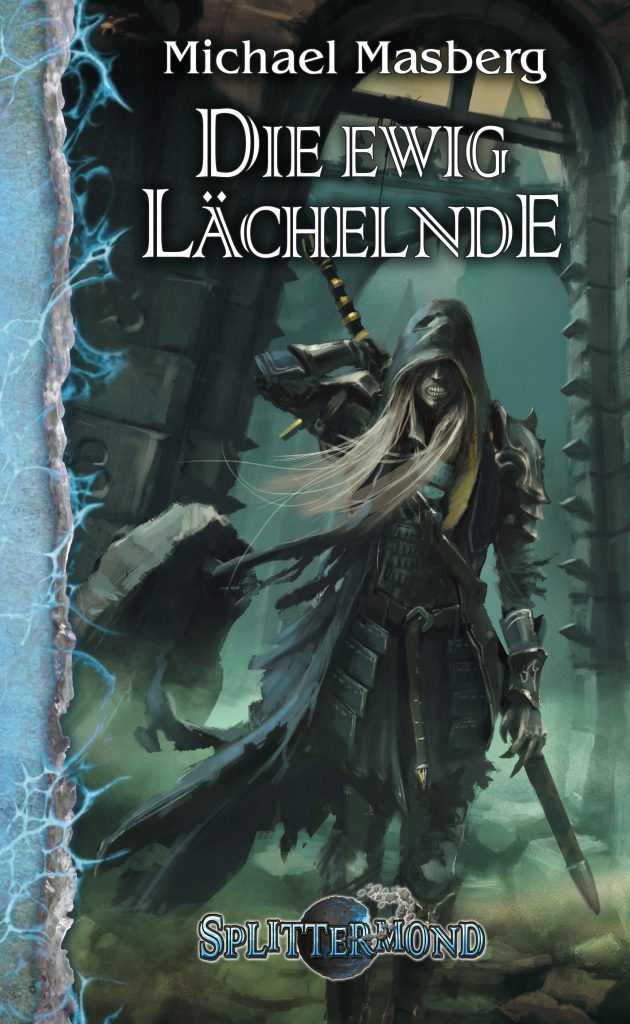

Egal für welchen Berufszweig auch immer, in manchen Bereichen ist ein Mindestlohnt einfach notwendig und für viele ein ganz wichtiger Schritt. Letztendlich sollte jeder am Ende genug verdienen, um problemlos seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können. Das ist leider in der heutigen Zeit immer öfters nicht der Fall.