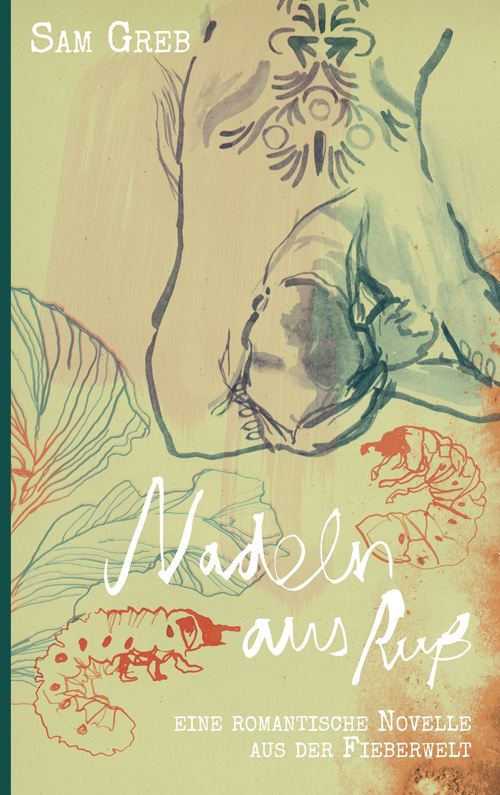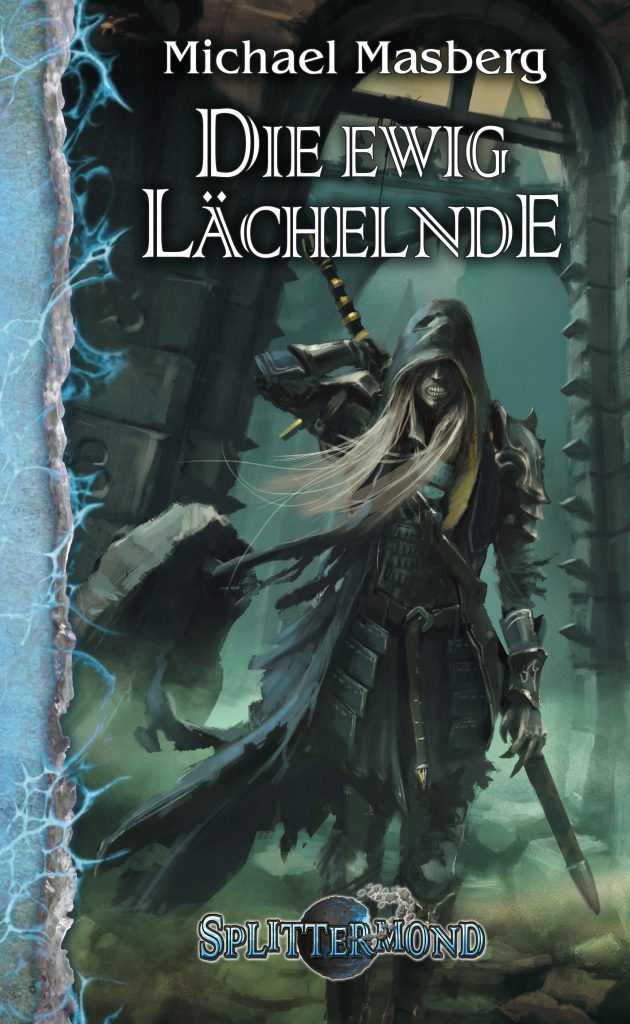Gegenlesen lassen. Überarbeiten. Gegenlesen lassen.
Zur Zeit gibt es wichtigere Themen, die mich beschäftigen. Istanbul etwa. Aber als Chronist der eigenen Sache ist es auch wieder an der Zeit, über, nun, mich zu schreiben. Vor allem aber aus Dankbarkeit für eine ganz besondere Hilfe.
Dass Der Nabel der Welten nun endlich kommt, habe ich bereits zur Genüge verbreitet. Auf die nächsten Schritte habe ich nur marginalen Einfluss. Während Korrektorat und Lekorat durchaus noch etwas mit dem Autor zu tun haben, vollziehen sich Satz, Druck und Vertrieb ohne Einbindung des Schreiberlings – wofür ich dankbar bin.
Nun sind Korrektorat und Lektorat in den letzten Jahren mitunter Anlass für so manches Witzchen gewesen. Da gibt es auch von meiner Seite aus nicht viel schönzureden, unter den Publikationen des Schwarzen Auges findet sich der eine oder andere unrühmliche Ausreißer. Zur Ehrenrettung ist jedoch zu sagen, dass sich dies bei den Abenteuern und Spielhilfen in letzter Zeit massiv gebessert hat. Wenn man etwa Mammutpublikationen wie die Gareth-Box oder den Kampagnenband Quanionsqueste nimmt – die nicht nur inhaltlich ein Lesegenuss sind, sondern sich auch eignen, Einbrecher in die Flucht zu schlagen –, belästigen einen Fehlerchen kaum noch.
Dennoch freue ich mich sehr, dass mir ein Herzenswunsch erfüllt wurde und Florian Don-Schauen das Lektorat und Korrektorat für Der Nabel der Welten übernahm. Nicht nur, weil Florian sich schon des ersten Teil, Der Kreis der Sechs, angenommen hatte. Als ehemaliger Chefredakteur ist er ein visierter Kenner des Hintergrunds, als Lektor eine Wucht. Florian arbeitet gründlich, ist unerbittlich und gleichzeitig fair – eine Mischung, die ich sehr schätze. Das Manuskript ist mittlerweile von seinem zu meinem Schreibtisch und wieder zurück gewandert. Und dies möchte ich zum Anlass nehmen, ihm ganz offen meinen herzlichsten Dank auszusprechen. Nicht nur hat er Fehler gefunden, für die ich einfach blind war, auch seine inhaltlichen Fragen, Anmerkungen und Vorschläge haben mir geholfen, dem Roman den letzten Schliff zu geben.
Ich habe immer gerne mit Florian gearbeitet und hoffe, dass sich auch zukünftig Gelegenheiten dazu finden. Unter allen Redakteuren des Schwarzen Auges, die in den letzten Jahren gingen, ist er für mich persönlich immer noch der größte Verlust, auch wenn für den Großteil der Spielerschaft sein Wirken wohl unsichtbar blieb. Was letztlich für einen Redakteur – der eher im Hintergrund konzipsiert, Autoren auswählt, moderiert und berät – eine große Auszeichnung ist.
Seit 2009 ist Florian als freier Lektor und Autor tätig. Wer also noch einen guten Lektor sucht, dem kann ich Florians Arbeit nur sehr ans Herz legen.